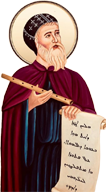Seine Heiligkeit Mor Ignatius Zakka I. Iwas
Patriarch von Antiochien und dem ganzen Osten und Oberhaupt der Universal-Syrisch-Orthodoxen Kirche
Die Leben spendende Karwoche
in der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien
Heidelberg, den 07.02.1996
Ruprecht-Karl-Universität Heidelberg
Übersetzt von Amill Gorgis
Die Leben spendende Leidenswoche (oder auch Karwoche) in der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien
Die Leben spendende Leidenswoche hat seit der frühen Christenheit in unserer heiligen Kirche einen besonderen Stellenwert. Diese Woche wird dem Fasten, dem Gebet und der Meditation über die Leiden unseres Herrn Jesus Christus, des Mensch gewordenen Gottes, ge-widmet, der die Leiden auf sich genommen hat, um die Menschheit zu retten. Darum haben die Kirchenväter den Ritus der Anbetung ein-gerichtet, indem sie die Werke verschiedener Gelehrter wie St. Aphrem des Syrers (†373) und St. Jacoubs (†512) aufgenommen haben. Es sind Fürbitten der Demut und Anbetung, die in Prosa und Versform geschrieben wurden. Sie sind in der Weise vertont worden, die ihrem Inhalt entspricht. Es ist in einer Weise, die ihrem Inhalt zusätzliches Gewicht verleiht und so Einfluss und Zugang in die Seelen der Menschen findet. Die Gebete steigen zu Gott empor und schaffen so eine Atmosphäre der Demut und der Gottesfurcht, in der die Menschen vor Gott, dem Erhabenen, der sie (die Menschen) so geliebt hat, winzig erscheinen: “Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat.” (Joh 3,16)
Der geistliche Inhalt der Riten ist eine zusammenfassende Wiedergabe der Dogmen, der Inkarnation und der Erlösung. Sie gehen ausführlich auf die prophetischen Aussagen und auf die Zeichen während des Leidens Jesu ein, die er aus eigenem Willen heraus ertrug. Das ist nicht verwunderlich, denn zwei Drittel des heiligen Evangeliums sind eine Beschreibung der Leben spendenden Stationen seines Leidens und ihrer ausführlichen Kommentierung gewidmet.
Darum lassen Sie uns, werte Anwesende, über das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus zu unserer Erlösung so meditieren, wie es unsere syrischen Kirchen-väter in den kirchlichen Riten für uns festgelegt haben. Wir beginnen mit dem demütigen Einzug Jesu in Jerusalem am Tag der Palmen. Während der Übergabe des heiligen Sakra-mentes an seine Jünger halten wir andächtig inne, nachdem Jesus vorher den Jüngern die Füße gewaschen hat.
Danach stellen wir uns vor, wie er verhaftet und von den geistlichen und weltlichen Mächten verurteilt wird, sein Kreuz durch Jerusalem trägt und auf Golgota an das Kreuz geschlagen wird, wie er stirbt, begraben wird und auf-ersteht. Lassen Sie uns tief über die Ereignisse meditieren, die uns bildhaft und lebendig durch die kirchliche Liturgie vor Augen geführt werden, um sie so zu erleben, wie sie sich wirklich zugetragen haben. Dadurch werden die göttlichen Wahrheiten den Ohren der Gläubigen nahe gebracht; sie setzen sich in ihrem Verstand fest und werden in ihren Herzen aufgenommen. So werden die Gläubigen durch das Opfer Jesu in ihrer Liebe und in ihrer Dankbarkeit zu Gott näher hingeführt. Denn er hat sein Blut für uns am Kreuz fließen lassen und starb, damit er uns das ewige Leben schenken konnte.
Palmsonntag
Die heilige Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien feiert das Fest der Palmenzweige nach dem Julianischen Kalender an dem Sonntag, der dem Ostersonntag vorangeht, damit sie im Geiste Gemeinschaft mit allen Aposteln und Rechtschaffenen haben, die den Herrn Jesus in Jerusalem mit Liedern der Freude und mit Öl- und Palmenzweigen empfingen. Die Gläubigen machten dies zur Tradition. Sie kommen an diesem Sonntag mit festlich gekleideten kleinen Kindern, denen sie Ölzweige und Kerzen in die Hände geben, um Jesus symbolisch so zu empfangen, wie ihn die Kleinkinder und Säuglinge am Tage des Ein-zugs in Jerusalem empfingen.
Der Tag, an dem Jesus in Jerusalem einzog, war ein heiliger Tag; denn er fiel in jenem Jahr nach dem Kalender des Alten Testamentes auf den 10. Tag des Monats Nisan. Es war Brauch, am 10. Tag des Monats Nisan ein Paschalamm auszusondern und es den Priestern zu bringen, damit sie beurteilten, ob es ohne Makel ge-wachsen und für das Opfer des Herrn geeignet sei oder nicht. Es wurde dann am 14. Tag desselben Monats, der dem Paschafest ent-sprach, geopfert.
So wollte es die göttliche Vorsehung, dass Jesus Christus als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, am Sonntag, dem 10. Nisan, zu den Priestern gebracht wurde. Er zog in Jerusalem mit großer Herrlichkeit auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttieres reitend, ein und wurde von der Volksmenge in der heiligen Stadt empfangen. Große und Kleine, Männer und Frauen, Klein-kinder und Säuglinge, die in ihren Händen Öl- und Palmenzweige hielten und vor ihm ihre Kleider ausbreiteten, riefen ihm Hosanna zu. Das heißt: “Gesegnet sei er, der da kommt im Namen des Herrn.” Das syrische Wort Uscha’no (Hosanna) bedeutet: “Herr, erlöse.”
Die Nachricht von dem Wunder der Auf-erweckung des Lazarus, der vier Tage tot und schon begraben war, hatte sich unter den Menschen verbreitet, die nun voller Verlangen waren, Jesus, den Propheten aus Nazareth zu sehen, der die sichtbaren Wunder vollbrachte.
Weil der Hass die Herzen der Hohenpriester und Priester versteinert hatte, verurteilten sie ihn zum Tode. Der Hohepriester sagte pro-phezeiend: “Es ist besser für uns, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht.” (Joh 11,50) So entschieden sie, dass Jesus von Nazareth als das Lamm Gottes, wie ihn Johannes der Täufer nannte, das die Sünde der Welt trägt, zum Pascha-Opfer geeignet sei. Es ist bemerkenswert, dass der Prediger Lukas erwähnt: “Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte: Wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit für dich kommen, in der deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten be-drängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem anderen lassen; denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt.” (Lk 19,41-44) Diese Prophe-zeiung wurde im Jahre 70 n. Chr. erfüllt, als der Römer Titus die Stadt belagerte und sie bis auf ihre Grundfesten zerstörte.
Die Ordnung der Segnung der Zweige
Unsere ehrwürdigen Väter haben die Ordnung für die Segnung der Zweige an diesem hoch gepriesenen Fest wie folgt festgelegt:
Auf einem Tisch vor der Königstür – also zwischen den beiden Chören – wird eine ausreichende Menge von Palm- und Ölzweigen aufgestellt. Nach Beendigung des morgend-lichen Stundengebetes zieht der Klerus be-kleidet mit seinen liturgischen Gewändern in einer Prozession vom nördlichen Tor des Heiligtums zum südlichen Tor. Der Bischof trägt die Ölzweige, die in Form eines großen Kreuzes gebunden sind. Die Priester und die Diakone tragen das Kreuz, das Evangelienbuch, das Weihrauchgefäß, die Fächer und die brennenden Kerzen. Während der Prozession singen sie in syrisch die für dieses Fest vorgesehenen Lieder. Wenn sie am Ende der Prozession wieder vor dem Heiligtum ange-kommen sind, beginnt der Bischof mit der Ordnung der Segnung der Palm- und Ölzweige. Dabei rezitiert er Gebete und Husoye (Ver-gebungsgebete). Es werden Lieder gesungen und aus der Heiligen Schrift folgende Texte verlesen:
1. Prophezeiung des Sacharja 9,9-11
2. 1 Joh 2,9-17
3. Röm 11,13-24
4. Der Bischof liest das heilige Evangelium nach Johannes 12,12-22
Danach beginnt er mit ausgebreiteten Armen mit dem Gebet zur Segnung der Zweige in der Melodie der Eucharistiefeier.
Am Schluss der Segnung der Ölzweige, die in der Form des Kreuzes gebunden sind, werden die vier Enden der Welt gesegnet, wie es bei jedem Fest üblich ist. Dieser Teil beginnt mit dem Satz: “Er, dem die Engel dienen…” Danach werden die Zweige an die Gläubigen verteilt, die sie in ihren Häusern das ganze Jahr hindurch aufbewahren, um durch die Zweige gesegnet zu werden. Beim nächsten Pal-menzweigfest werden die Zweige verbrannt und durch neue ersetzt. Nach der Ordnung der Segnung der Zweige feiert der Bischof die Eucharistiefeier, dann hält er die Predigt und schließt mit dem Segen.
Die Ordnung der Nahire (Öllampen) oder das Erreichen des Hafens
Diese Ordnung wird am Abend des Palm-sonntags begangen – also im Nachtoffizium des Montags –, der als erster Tag der Karwoche gilt. Die Melodien werden im Ton der Hascho (Trauer) gesungen.
Nachdem wir morgens: „Hosanna“ (Herr, erlöse), „gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn“, rufend den Einzug des Herrn Jesus in das irdische Jerusalem gefeiert haben, begehen wir am Abend des Palmsonntags die Ordnung der Nahire (Lichter). Sie stellt unseren Einzug mit Jesus in das himmlische Jerusalem – ins Himmelreich – dar. In dieser Ordnung betrachten wir das Dogma der zweiten Wieder-kunft Christi in seiner großen Herrlichkeit, um die Lebenden und die Toten zu richten (Mt 25,31-46). Von dieser Ankunft, deren Zeitpunkt wir nicht kennen (Mt 24,42), hat unser Herr ausführlich berichtet und aufgezeigt, welche Drangsale ihr vorangehen werden. Wir glauben, dass er, gelobt sei er in Herrlichkeit, wieder-kommt und sein heiliges Zeichen, das Zeichen des Kreuzes, am Himmel sichtbar wird. Er wird wiederkommen auf einer Wolke. Dann wird ihn jedes Auge erblicken, so wie er es prophezeite. Der Erzengel wird die Trompeten blasen und alle, die in den Gräbern liegen, werden die Stimme des Sohnes Gottes hören. Dann werden jene herauskommen, die Gutes getan haben, und ihre Auferstehung wird für das ewige Leben sein; aber bei jenen, die Schlechtes getan haben, wird die Auferstehung zur Verdammnis werden. Die Leiber der Rechtschaffenen wer-den in geistliche Leiber verwandelt und mit Christus empor fahren. Denn die Rechtschaffenen warten ungeduldig auf sein Wieder-kommen, damit sie die Belohnung für ihre guten Taten empfangen.
Während dieser Ordnung wird das Kapitel 25 aus dem Evangelium nach Matthäus gelesen, die Verse 1 bis 13. Es handelt sich um das Gleichnis von den fünf törichten und den fünf klugen Jungfrauen. Die Gläubigen, die sich mit festem Glauben und in unerschütterlicher Hoffnung in der Kirche versammelt haben, tragen die leuchtenden Kerzen als Symbol für die Öllampen der fünf klugen Jungfrauen, deren Lampen voller Öl waren. Das Öl ist ein Symbol für die Werke der Liebe und der Barmher-zigkeit, die rechtschaffene Gläubige tun. Und diese Werke haben die fünf klugen Jungfrauen getan, als sie geduldig auf den Bräutigam warteten.
Innerhalb der Ordnung dieses Tages findet eine Prozession statt, bei der der Bischof, die Priester und die Diakone durch die Kirche ziehen. Die Lichter werden in der Kirche als Symbol für die Dunkelheit dieser Welt aus-geschaltet, in der wir in unserem irdischen Dasein leben. Sie tragen brennende Kerzen als Symbol für ihren Glauben, ihre Hoffnung und
ihre Liebe in ihren Händen. Die brennenden Kerzen werden in ihren guten Werken sichtbar und bestätigen die Worte des Herrn: “So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.” (Mt 5,16) Einige unserer Gemeinden haben die Tradition bewahrt, indem sie auf der linken Seite, wo die Frauen sitzen, die Prozession beginnen. Wenn die Prozession den Altar erreicht hat, ist der Vorhang noch zugezogen. Es werden Vergebungsgebete, Gebete der Buße und der Reue gesprochen, um Barmherzigkeit und Vergebung vom Herrn zu erbitten. Die Gebete sollen die Gläubigen vor-bereiten, in den Himmel einzutreten, wenn Jesus in Begleitung der fünf klugen Jungfrauen, die auf sein Kommen gewartet haben, erscheint. Ihre Öllampen waren gefüllt, und sie hatten auch Öl in Krügen mitgenommen. Vor den Stufen des Altares knien der Bischof, die Priester, die Diakone und die Gemeinde nieder. Voller Anbetung rufen sie 40-mal: Kyrie eleison, Herr erbarme dich. Danach vollenden sie das Gebet der Buße mit gebrochenem Herzen. Dann wird das Glaubensbekenntnis gesprochen. Danach tritt der Bischof mit dem heiligen Kreuz in der Hand vor und klopft an den Vorhang, der die Tür zum Himmel symbolisiert. Er spricht dreimal ein Bußgebet in Liedform. Es beginnt so: “An der äußeren Tür saß weinend Simon: Rabbi, öffne mir die Tür, denn ich bin dein Jünger. Himmel und Erde weinen über mich, weil ich die Schlüssel zum Himmel verlor.” Jedes Mal antwortet die Gemeinde mit demselben Lied. Danach berührt der Bischof den Vorhang zweimal mit dem Kreuz und ruft: ”Herr, Herr, öffne uns deine Tür.”
Nachdem er den Satz dreimal wiederholt hat, wird der Vorhang aufgezogen und die Lichter in der Kirche erstrahlen wieder. Der Bischof und die Teilnehmer der Prozession treten in das Heiligtum ein. Sie symbolisieren die Rechtschaffenen, die bei der Wiederkunft Christi mit ihm in das himmlische Königreich eintreten werden. Dann folgt eine Predigt über die Wiederkunft Christi und anschließend wird ein besonderes Lied über das Leiden unseres Erlösers gesungen. Schließlich entlässt der Bischof die Gläubigen. Erwähnenswert ist auch, dass die Wurzeln dieser Ordnung bis in das 7. Jahrhundert zurückreichen.
Als Vorbereitung für die Karwoche werden die Wände der Kirche mit schwarzen Tüchern behängt. Alle Tücher des Altars, der Kelch, die Patene wie auch alle anderen Gefäße, die während der Eucharistiefeier verwendet werden – einschließlich dem Tablith (ein flaches Holz) –, das unter den Kelch und die Patene gestellt wird, und somit auf die Kreuzigung Christi hindeuten, werden weggeräumt. Der Altar wird so zu einem Symbol für Golgota.
Das Paschafasten oder das Fasten in der Karwoche
Das erste Fasten, das die Kirche den Gläubigen auferlegte, war das Paschafasten – auch das Fasten der Karwoche genannt. Dabei fasten die Gläubigen vom Nachmittag des Karfreitags an bis nach Mitternacht des Ostersonntags. Sie gedenken der Leiden unseres Herrn Jesus, seiner Kreuzigung und seines Todes, um an den lebenspendenden Leiden Jesu Anteil zu haben, die Jesus Christus um unserer Erlösung willen ertrug. So verkündet dies der Apostel Paulus:
“Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben.” (Röm 6,6) Die Kirche beging seit ihrer Entstehung dieses Fasten, und feierte das Leiden unseres Herrn, seinen Tod und seine Auferstehung alle 33 Jahre. Weil die Kirche aber feststellte, dass viele geboren wurden und starben, ohne an dieser Feier des heiligen Gedenkens teil-genommen zu haben, wurde beschlossen, es jährlich zu begehen.
Mit der Zeit hat man dieses Fasten um vier Tage verlängert. So wurde daraus eine Woche, die dann die Karwoche genannt wurde. Sie beginnt mit dem Morgen des Montags, der dem Palmsonntag folgt und endet am Morgen des Ostersonntags. Es wurde bis zum Abend gefastet, indem die Gläubigen nichts aßen und tranken.
Am Abend unterbrachen sie das Fasten; sie aßen Brot mit Salz und tranken Wasser. Heute enthalten sich die Gläubigen bis zum Mittag oder bis zum Abend allen Essens und Trinkens. Danach unterbrechen sie ihr Fasten mit einem rein vegetarischen Essen, das z. B. aus Weizen, Hülsenfrüchten und Obst besteht. Diese Mahlzeiten sind von Fleisch und jeglichen tierischen Produkten frei, um an den Leiden unseres Erlösers teilzuhaben, als ihn dürstete, und er mit Essig und Galle getränkt wurde.
Das Gebet in der Karwoche
Die Gebete, die in den wunderschönen Melo-dien der Lieder Gehör finden, die Lesungen der Heiligen Schrift und besonders des heiligen Evangeliums, die in der Leidenswoche am Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils morgens, mittags und abends gelesen werden, handeln von den Lehren des Erlösers, in denen er über sein uns erlösendes Leiden redet. Darin bestätigt er, dass er gekommen ist, um die Leiden für uns zu ertragen und die Menschheit zu erlösen.
Das heilige Evangelium erwähnt mehrere Gleichnisse und Aussagen des Herrn, die von seinem göttlichen Wissen zeugen. Die Hohen-priester, die Priester und die Pharisäer versuch-ten, ihn in eine Falle zu locken, damit sie durch eine ungeschickte Formulierung seinerseits einen Grund fanden, ihn gefangen nehmen zu lassen.
Der Pascha-Donnerstag
Der Pascha-Donnerstag wird auch Donnerstag der Geheimnisse (Sakramente) genannt. Die heilige Kirche begeht ihn mit der Feier der heiligen Eucharistie. Es werden einige Kapitel aus der Heiligen Schrift verlesen, in denen die Gläubigen an das furchterregende Ereignis, an die Zusammenkunft unseres Herrn Jesus mit seinen Jüngern im oberen Raum, in dem er das jüdische Paschamahl mit ihnen einnahm und ihnen das Sakrament seines heiligen Leibes und Blutes einsetzte, erinnert werden.
Im heiligen Evangelium nach Matthäus steht geschrieben: „Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte: Nehmt und esst; das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten: Trinkt alle daraus; das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.“ (Mt 26,26-28) „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ (Lk 22,19)
Dieses Geheimnis (Sakrament) wird das Geheimnis aller Geheimnisse genannt. Der Herr hat es vorbereitet, indem er über sich selber
sagte: “Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.” (Joh 6,51) Und er sagte weiter: “Amen, amen, das sage ich euch: Wenn ihr das Fleisch des Menschen-sohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm.” (Joh 6,53-56)
Christus, der unter dem Gesetz geboren wurde, hat das Gesetz erfüllt. Er hat das jüdische Pascha mit seinen Jüngern in der Nacht seines Leidens genommen, und dann übergab er ihnen das christliche Pascha, das unblutige Opfer, als er ihnen das Geheimnis seines heiligen Leibes und Blutes anvertraute, bevor er seinen Leib freiwillig zur Kreuzigung überantwortete. So bereitete er dem Tieropfer ein Ende und gab dem unblutigen Opfer den Vorzug, das Melchisedek, König von Salem, symbolhaft dargebracht hatte; denn jener hatte
nur Brot und Wein geopfert. Darum sagt der Apostel Paulus vom Herrn Jesus: “Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchi-sedeks” (Hebr 5,6), und er sah in Jesus das neue Paschalamm.
Dass aber unser Herr Jesus Christus das Pascha gefeiert hat, geschah lediglich um das Gesetz zu erfüllen. Die Opferung des Pascha-lammes war ein Symbol für Jesus Christus, von dem der Apostel Paulus sagt: “Denn als unser Paschalamm ist Christus geopfert worden.” (1 Kor 5,7) Das hebräische Wort Pascha bedeutet Überquerung und deutet auf das Vorübergehen des Totenengels an den Wohnhäusern des Vol-kes des alten Bundes hin, ohne ihren Erst-geborenen irgendeinen Schaden zuzufügen, wenn er das Blut des Paschalamms in Form eines Kreuzes auf dem Türsturz und an den beiden Türpfosten sah. Die Heilige Schrift sagt den Herrn zitierend: “Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen.” (Ex 12,13) So stand Jesus mit seinen Jüngern zwischen den beiden Paschamahlen. Sie aßen das alte Pascha-mahl mit den bitteren Kräutern und hatten ihre Lenden in der Weise des Volkes des alten Bundes gegürtet. Dann aßen sie das neue
Pascha mit der Bitternis des Leidens der Seele aufgrund der Ankündigung des Herrn, dass er sich bald als Opfer für die Menschheit darbringen werde. Christus ist unser Pascha, er hat uns von der neuen Sünde befreit, indem er sein teures Blut am Kreuz vergoss. Er rechtfertigte und heiligte uns und machte uns würdig, durch Gnade Kinder des himmlischen Vaters und Erben des Himmelreiches zu wer-den. An diesem Paschafest wird den Gläubigen kanonisch auferlegt, vor den Priestern zu beichten und aufrichtige Buße zu tun. Danach nehmen sie an der heiligen Eucharistiefeier teil und empfangen das heilige Abendmahl, um in Christus zu bleiben.
Wie wir den Kardonnerstag, also den Pascha-Donnerstag, heutzutage zelebrieren
Patriarch Aphrem Barsaumo I. erklärt das wie folgt: “Am Donnerstagmorgen wird die gött-liche Liturgie zelebriert; das heilige Abendmahl empfangen diejenigen, die kanonisch gebeichtet haben. Dann wird ein Frühstücks-Fastenmahl eingenommen. Das Mittagessen besteht eben-falls aus einem Fastenmahl. Es wird heute in der gesamten syrischen Kirche so praktiziert. Früher aber wurde die göttliche Liturgie am Kardonnerstag nach der neunten Stunde – also am frühen Abend – gefeiert; und die Gläubigen empfingen das heilige Abendmahl gegen Sonnenuntergang. Naturgemäß aßen sie erst danach ein Fastenmahl.
Der vierte Kanon, den die Synode zu Latakia erließ (1. Kapitel des 5. Teiles aus dem Buch Hudoje [Die Leitung]) bedeutet in seinem Inhalt nicht wie angenommen wird, ein nor-males Fastenmahl zu sich zu nehmen, sondern es war früher vielmehr so, dass einige Gläubige den Kardonnerstag zum Ostersonntag machten. Und somit beendeten sie das Fasten.
Die kirchlichen Kanones schreiben vor, dass es nicht zulässig ist, einen Rest der Opfergabe (konsekriertes Brot und Wein), die am Kar-donnerstag konsekriert wurde, bis zum nächsten Tag – den Karfreitag –, aufzubewahren. Dieser Gedenktag ist der Tag, an dem der Herr Jesus sich selbst als Opfer dargebracht hat, um freiwillig am Kreuz zu sterben.
Die Ordnung der Fußwaschung wurde früher vor der Eucharistiefeier vollzogen; die Eucharistiefeier wurde am frühen Abend zelebriert. In der letzten Zeit wurde die Eucharistiefeier am Vormittag gefeiert wegen der dreistündigen kanonischen Gebete am Abend und wegen der Weihe des heiligen Myrons, die vor der Eucharistiefeier zu vollziehen ist, wenn diese denn vorher notwendig ist.
Aus diesem Grunde wird die Fußwaschung heute am frühen Abend vollzogen. Es werden ein Stuhl für den Bischof und 12 Stühle für die Priester und Diakone, die die Apostel bei dieser Ordnung darstellen sollen, aufgestellt. Dann wird das Evangeliar auf das Lesepult, das Gol-gota heißt, gelegt. Anschließend liest einer der Priester oder Diakone das für diese Ordnung bestimmte Kapitel aus dem Evangeliar.
Danach nimmt der Bischof auf seinem Stuhl Platz und ruft hintereinander die Namen der Apostel auf. Jeder der für die Zeremonie der Fußwaschung bestimmten Priester, Diakone, Subdiakone bzw. Lektoren erhält einen Apo-stelnamen. Nachdem der Bischof den ersten Apostelnamen aufgerufen hat, tritt der betref-fende Namensträger vor, verneigt sich vor dem
Altar, dem Evangeliar und dem Bischof, um dann seinen ihm zugewiesenen Platz einzu-nehmen. Jeder trägt das seinem klerikalen Rang entsprechende Amtskleid. Der Priester erscheint in seinem Epittra-Chelion, der Diakon in sei-nem Stoicharion und Orarion und die der niedrigen Ränge in ihren Hemden und Orarien oder nur Hemden.
Im Anschluss daran beginnt der Bischof mit dem Gebet. Alle Gebete dieser Feier werden von typischen Liedern/Hymnen der Liturgie für die Karwoche begleitet. Diesem Teil schließen sich nun Lesungen aus der Heiligen Schrift durch die Diakone an. Dann folgt die Lesung des für diesen Tag der Karwoche vorge-schriebenen Kapitels aus dem Evangeliar durch den Bischof. Ein Priester oder ein Diakon beenden die Lesung.
Gemäß dem Brauch, wenn der Lektor beim Lesen an die Stelle gelangt ist, die über Jesus folgendes sagt: „…legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch…“, erhebt sich der Bischof, nimmt das bereitliegende Leinentuch, umgürtet seine Lenden, gießt Wasser in eine Schüssel und beginnt mit der Fußwaschung bei den Jüngern. Er beginnt bei
dem Letzten, und wenn der Bischof zu dem kommt, der Petrus darstellt, der meistens ein Priester ist, lehnt dieser eine Fußwaschung durch den Bischof ab. Der Bischof führt mit ihm ein Zwiegespräch, an dessen Ende der Bischof dann doch seine Füße wäscht. Der Dialog zwischen dem Bischof und Petrus wird so geführt, wie er auch im Neuen Testament zwischen Jesus und Petrus geführt wird. Danach sammeln sich alle, deren Füße gewaschen, getrocknet und mit natürlichem Öl gesalbt wurden, um ihrerseits dem Bischof die Füße zu waschen, zu trocknen und sie auch mit natürlichem Öl zu salben.
Der Bischof beginnt mit der Lesung des Evangeliums, nachdem er das Leinentuch abgelegt und sein Gewand wieder angelegt hat. Anschließend hält er eine Predigt über die Lehre, die diese Ordnung der Fußwaschung uns gemäß dem Herrengebot erteilt, indem wir auf die Demut unseres Herrn schauen und uns an ihr ein Vorbild nehmen. Nach der Predigt sprechen die Gläubigen das Nizänum und einige Gebete; sodann werden sie vom Bischof mit dem Segen entlassen.
Der Karfreitag
Die heilige Kirche gedenkt am Karfreitag der Tragödie von Golgota. Darum wird der kirch-liche Raum mit schwarzen Tüchern ausgeklei-det. Dies ist ein Zeichen für die Trauer und die Betrübnis über den Tod Jesu.
In ihren ausführlichen in Prosa und Vers-form verfassten Gebeten sowie Lesungen aus der Heiligen Schrift werden die Prophezeiungen veranschaulicht, die auf das Leiden des Erlösers hindeuten. Denn was am Tage der Kreuzigung unseres Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha geschah, war nicht einfach eine spontane Entscheidung der Stunde, sondern es war ein Ereignis, das Gott durch zahlreiche Prophe-zeiungen, Zeichen und Symbole lange vorher angekündigt hatte.
Das ist das Anliegen dieser heiligen Ord-nung (Ritus). Ganz besonders geschieht dies in den Lesungen der Heiligen Schrift. Die Kirche möchte, dass wir uns mit dem Auge des Geistes Jesus, das Sühneopfer der Menschheit, vor-stellen. Wir sollen uns immer wieder vorstellen, wie er ungerecht verurteilt und gerichtet wird, wie er Leiden auf sich nimmt, gegeißelt und geschlagen wird, sein Kreuz an den spottenden
Menschen vorbeiträgt, und wie er schließlich an das Kreuz zwischen Himmel und Erde ge-schlagen wird.
Es kommt mir vor, als wäre er aus dem Himmel ausgestoßen, weil er sich bereit erklärte, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Die Sünde ist von Gott verworfen, und die Erde hat ihn ausgestoßen, weil er ihre Hohenpriester gerügt, ihre Pharisäer gescholten sowie die vom rechten Wege Abgekommenen getadelt hatte. Er wurde darum an das Kreuz geschlagen, um zwischen Himmel und Erde eine Brücke zu schlagen, um Gott, seinen Vater, mit den Menschen, der er, Jesus, einer von ihnen geworden ist, zu versöhnen und um den Fluch, der auf dem Holz lastete, in Gnade zu verwandeln.
Ja, er machte das Kreuz zu einer Leiter, auf der die, die an ihn als Erlöser der Menschheit glaubten und dadurch gerechtfertigt und gehei-ligt wurden, gen Himmel emporsteigen und als Kinder Gottes durch seine göttliche Gnade Erben seines himmlischen Reiches werden konnten. Die Kirche betont damit, dass der Mensch gewordene Gott, Jesus Christus, der selber sein Leiden, seinen Tod und seine
Auferstehung prophezeite, und der seinen Jüngern vor dem Geschehen von den künftigen Ereignissen erzählte, bewies, dass er die Kreuzigung und den Tod freiwillig auf sich genommen hat.
Die Kirche will mit dem Zelebrieren dieses heiligen Karfreitags dazu aufrufen, dass wir Christus durch Buße und Unterlassung unseres sündhaften Lebenswandels als unseren Erlöser annehmen, in ihm leben, seinen Willen erfüllen, sein Kreuz tragen und ihm auf den Weg nach Golgota folgen, wie es der Apostel Paulus in seiner Epistel an die Galater sagt: „…Ich bin mit Jesus gekreuzigt worden; nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“ (Gal 2,19) Die Kirche bekennt, dass Jesus Christus, der am Kreuz starb, seinen Geist in die Hände seines Vaters legte. Ja, er ist der fleischgewordene Gott, und seine Gottheit trennte sich von seinem Menschsein, von seinem Geist und von seinem Leib nicht für einen Moment.
Diesbezüglich sagte Mor Ishoq (Isaak): „Der Ruhm der Kirche ist es, dass Gott am Kreuz starb.“ Im Folgenden werden die wichtigsten Ritualien des Karfreitags beschrieben:
Liturgie der Kreuzanbetung und die Bestattung des Kreuzes
Während der Gottesdienste ist der Platz des Bischofs für die Dauer der gesamten Karwoche außerhalb des Altarraumes.
Nach der Beendigung des Gebetes der dritten Stunde am Morgen des Karfreitags legen die Priester schwarze Gewänder an. Der Bischof trägt auf seiner Schulter ein hölzernes Kreuz ohne Kruzifix. Die Prozession beginnt von der südlichen Tür der Kirche. Vor dem Kreuz wird das Weihrauchgefäß hin- und hergeschwenkt und die Rhipidien werden über ihm geschellt. Die Priester führen den Zug der Prozession an; ihnen folgt der Bischof. Sind sie an die mittlere Tür des Altars – dem Ende der Prozession – angelangt, wird das heilige Kreuz auf eine von einem Diakon bereitete kreuz-förmige Erhöhung gestellt. Zu beiden Seiten des Kreuzes werden brennende Kerzen aufgestellt, die die zu beiden Seiten Christi gekreuzigten Verbrecher darstellen. Wenn der Lektor an die Textstelle gelangt, die da heißt: „…der andere aber wies ihn zurecht…“, löscht ein Diakon die linke Kerze aus. Das bedeutet, der rechte Verbrecher wies den linken Verbre-
cher, der zusammen mit denen, die unter dem Kreuz standen und die alle Jesus verhöhnten, zurecht. Gelangt der Lektor dann an die Stelle, die da heißt: „…der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei…“, wird der Vorhang zum Heiligtum nur bis zur Hälfte aufgezogen. Und während der Prozession singt die Geistlichkeit Lieder der Passionszeit. Die Gefäße, die Einbalsamierungs- und Duftstoffe, Öle und Weihrauch werden auf einem großen Teller auf den Altar nieder gelegt.
Nach dem Gebet der neunten Stunde legt jeder Priester sein schwarzes Epittra-Chelion und der Bischof sein volles schwarzes Gewand an. Sie beginnen mit der Liturgie der Anbetung des Kreuzes. Sie enthält Gebete und die Lesung aus der Heiligen Schrift (Joh 9,25-37).
Gelangt der Lektor dann an die Stelle, die da lautet: „…man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen… Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem andern, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht…“, zerbricht ein Diakon die links und rechts vom Kreuz stehenden Kerzen.
Am Ende der Lesung des Evangeliums hält der Bischof eine Predigt über die Errettung, die die Gläubigen durch das Leiden und die Kreuzigung unseres Heilands, Jesus Christus, empfangen haben.
Danach steht der Bischof vor dem erhöhten Kreuz, trägt das Weihrauchgefäß und bringt Weihrauch dar. Er singt folgenden Vers dreimal: „Wir verneigen uns vor dem Kreuz, durch das wir Errettung unserer Seelen empfangen haben. Gemeinsam mit dem Räuber rufen wir: Erinnere dich unser, Christus, wenn du wiederkommst.“ Im Anschluss daran werden die vier Enden der Welt mit dem bekannten Satz: “Er, dem die Engel dienen…”, gesegnet.
Die Verherrlichung des Kreuzes ohne das Kruzifix an diesem und jedem folgenden Tage nach dem Brauch unserer Kirche erinnert uns an die kupferne Schlange, die das Kreuz symbolisiert, über das Jesus zu Nikodemus sagte: „Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der (an ihn) glaubt, in ihm das ewige Leben hat.“ (Joh 3,14)
Nach den Überlieferungen unserer Kirchenväter in dem Buch der Zeremonien, das die
gesamten Ritualien der Festtage enthält, trägt der Bischof das Kreuz auf den Armen, wie der tote Leib unseres Herrn getragen wurde. Alsdann beginnen die Priester und Diakone mit dem Singen der Hymnen, sobald die Prozession von der nördlichen Seite kommend, beginnt. Haben sie den Altar erreicht, steigt der Bischof auf eine Treppe und wäscht das Kreuz mit Rosenwasser, wie Joseph und Nikodemus es mit dem Leib des Herrn getan haben, ehe sie ihn zu Grabe trugen. Danach balsamiert der Bischof das Kreuz mit Duftstoffen und Ölen ein und gibt Weihrauch hinzu, umhüllt es mit einem feinen Leinentuch, bindet ein weißes Tuch um sein oberes Ende, dass das Haupt unseres Herrn darstellt und umgürtet die Lenden mit einer Binde. Dann bestattet der Bischof es an den für diesen Zweck vorgesehenen Platz, der sich meistens hinten unter dem Altar befindet.
Am darauf folgenden Samstag, der der Samstag der Frohen Botschaft genannt wird, darf an jenem Opfertisch keine göttliche Liturgie gefeiert werden, sondern an einem anderen Opfertisch. Das Gesicht des Kreuzes muss nach Osten gerichtet sein; dann wird das
Grab bedeckt und mit Wachs versiegelt. Ein Leuchter mit einer angezündeten Kerze wird vor das Grab aufgestellt. Danach beginnt der Bischof singend mit dem Einleiten des Lob-gesanges der Engel und die Gemeinde stimmt ein. Gleichzeitig beweihräuchert er das Grab und die Gemeinde. Wenn sie dann beim Singen an die Stelle gelangen: „Heilig bist du, o Gott, heilig bist du Allmächtiger, heilig bist du Unsterblicher, der du für uns gekreuzigt wur-dest, erbarme dich unser“, singt diese Stelle der Bischof zunächst alleine; dann wiederholen sie die Priester, Diakone, und anschließend wie-derholt die gesamte Gemeinde. Auf eine lange Tradition aufbauend, glaubt unsere syrische Kirche, dass dieses sehr alte, als Trishagion bekannte, Gebet an Jesus Christus gerichtet ist. Nach unserer Tradition lobpreisten die Engel den Herrn mit jenen Worten, als Joseph und Nikodemus den heiligen Leib zu Grabe trugen: „…Heilig bist du, o Unsterblicher,“ und Joseph und Nikodemus setzten die Lobpreisung nach der der Engel mit den Worten fort: „Der du für uns gekreuzigt wurdest, erbarme dich unser.“
Daran anschließend wird das Vaterunser gebetet, dem das Nizänum folgt. Daraufhin entlässt der Bischof die Gemeinde mit dem Segen.
Die Gläubigen trinken das mit Essig und Myrrhe vermischte Rosenwasser, mit dem das heilige Kreuz gewaschen wurde, um Segen zu empfangen. Sie werden aber davor streng ge-warnt, nichts von der Flüssigkeit zu ver-schütten. Denn der Brauch unserer Väter lehrt, dass die Gläubigen in der Karwoche – besonders am Karfreitag – keine Süßigkeiten zu sich nehmen dürfen, weil Jesus Christus, als ihm dürstete und er nach Wasser verlangte, Essig vermischt mit Galle in einem Schwamm gereicht erhielt.
Die Gläubigen machten es zur Gewohnheit, in dieser Woche bei der Begrüßung und beim Friedensgruß sich nicht zu küssen, weil Judas mit einem Kuss seinen Herrn verraten hatte. Hinzukommt, dass wir am Karfreitag keine göttliche Liturgie zelebrieren. Wir zelebrieren in den Tagen der Karwoche und des Qua-dragesimae die sogenannte Weihe des Kelches, die eine Weihe der schon geweihten Pros-phoron darstellt. Wir beschränken uns darauf, die göttliche Liturgie in der Fastenzeit nur an Samstagen und Sonntagen zu halten.
Während wir uns in den Wochentagen der Fastenzeit auch der Fastenmahlzeiten enthalten, wird dies zur Ehre Gottes an den Herrentagen – Samstag und Sonntag – nicht getan. Das gilt allerdings nicht für den Karsamstag.
Die Rhipidien werden auf beiden Seiten der Stelle aufgestellt, an der das Kreuz bestattet wurde. Die Rhipidien stellen die Wächter dar, die von der Regierung im damaligen Jerusalem zur Bewachung des Leibes Christi an das Grab Christi gestellt wurden. Keiner darf vor Sonnabend nach Mitternacht, in der Maria (Maria aus Magdalena), Maria (die Mutter des Jakobus) und Salome zum Grab gingen, und der Engel ihnen die gute Nachricht brachte, dass Jesus auferstanden ist, in die Nähe jenes Grabes gelangen. Es ist niemandem erlaubt, vor Samstag nach Mitternacht – also dem Anbruch des Sonntages – die Zeit, in der die beiden Marias zum Grab kamen und von dem Engel des Herrn die Frohe Botschaft empfingen, dass Jesus, der Herr, von den Toten auferstanden ist, die Stelle betreten, an der das Kreuz bestattet wurde. In dieser Zeit erscheint der Bischof und bewegt die Fächer und öffnet die Stelle, an der das Kreuz bestattet wurde. Er trägt das Kreuz
hinaus und verkündet der Gemeinde: “Jesus ist von den Toten auferstanden.”
Der Karsamstag
Wie bereits schon oben erwähnt wurde, ist der Samstag der einzige Tag in der Fastenzeit, an dem wir uns bis zum Mittag des Essens und des Trinkens enthalten. Am Mittag wird dann die göttliche Liturgie auf einem anderen Opfer-tisch, als dem, unter dem das Kreuz beigesetzt worden ist, zelebriert.
An diesem Tag wird nach der neunten Stunde – also um 15 Uhr nachmittags – die Ordnung der Vergebung vollzogen, in der die Gebete der Buße und der Reue gebetet werden. Es wird auch zu Gott gerufen, uns würdig zu machen und uns unsere Sünden zu vergeben, so wie Gott durch Jesus unsere Sünden vergab. Dann wird aus dem Evangelium des Matthäus (12,15) gelesen. Nach der Lesung fallen die Gläubigen auf die Knie und erbitten gegenseitig von sich Vergebung und Versöhnung. Im Anschluss daran wird das Abendgebet zur Auferstehung Jesu als Vorbereitung für das Zelebrieren der göttlichen Liturgie anlässlich der Auferstehung Christi nach Mitternacht des Karsamstages gebetet.
Die Auferstehung bewies, dass Gott, der Vater, in Wahrheit das Opfer seines einzigen Sohnes angenommen hat, der durch sein Opfer den Tod, die Sünde und den Satan besiegte und den Gläubigen die Gnade der Rechtfertigung, der Heiligung und der Kindschaft schenkte, damit sie das Himmelreich als Kinder Gottes erben.
Gott hat uns geholfen, Ihnen an der Theologischen Fakultät zu Heidelberg aus der reichen syrischen Tradition etwas über die Liturgie der lebenspendenden Karwoche vorzu-tragen. Wir danken für die Einladung und danken Ihnen allen für das Zuhören. Gott möge Sie alle segnen.